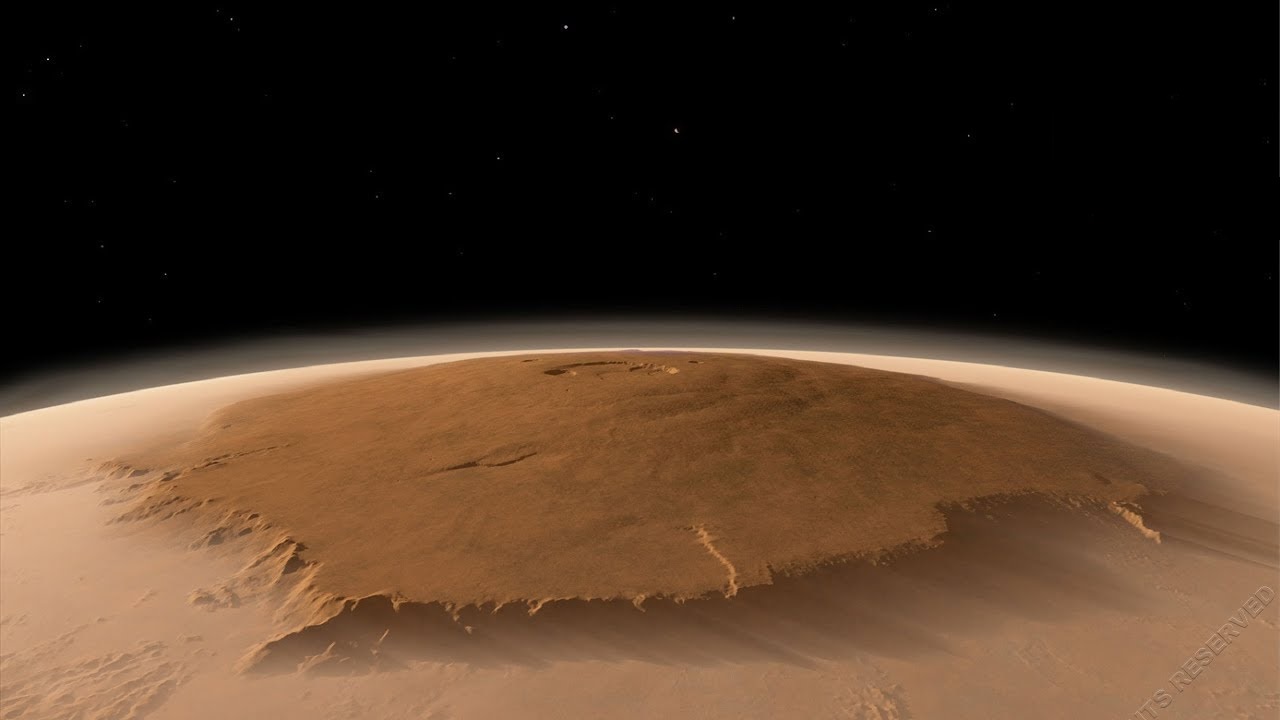„Chaos inmitten von Chaos ist nicht witzig.
Aber Chaos inmitten von Ordnung ist es.“
Steve Martin
Die menschliche Geschichte besteht also, wenn man sie mal so in ihren verschiedenen Abschnitten betrachtet, zum großen Teil aus Chaos. Zumindest erscheint ein nukleares Wettrüsten zwischen zwei verfeindeten Supermächten als soviel Chaos, wie man nur ertragen kann. Gefährlich ist es allemal.
Schon scheinbar recht simple Fragen können bei genauerem Hinsehen ein echtes Problem darstellen. „Wann begann der 2. Weltkrieg?“ wäre so eine Frage.
Nun, für Europa ist diese Frage simpel zu beantworten und wir alle sollten die Antwort aus der Schule kennen: Am 1. September 1939. Aber wie sieht das eigentlich insgesamt aus? Immerhin bezieht sich die Frage ja auf einen Weltkrieg.
Für die USA begann der 2. Weltkrieg nicht vor dem 7. Dezember 1941, das war der Tag, an dem die japanische Flotte ihren Überraschungsangriff auf Pearl Harbour auf Hawaii durchführte.
Für die Sowjetunion begann der Krieg nicht vor dem 22. Juni 1941, dem Tag, an dem das bis dahin verbündete Hitlerdeutschland seinen Überfall auf Stalins Machtbereich begann.
Für den asiatischen Raum kann man hier das Jahr 1937 nehmen, als Japan im Juli des Jahres den Krieg gegen China eröffnete, nach dem sogenannten „Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke“. Eigentlich begann diese Serie aus Zwischenfällen, die letztlich nicht weiter als Auftakt zum Krieg waren, sogar bereits 1931.
Nördlich eines Ortes namens Mukden sprengte damals ein japanisches Kommando ein Stück der Südmandschurischen Eisenbahn in die Luft und brachte so einen Zug zum Entgleisen. Zumindest war das der Plan. Der mißlang zwar, aber zumindest konnte man diesen Zwischenfall den chinesischen „Banditen“ in dieser Gegend in die Schuhe schieben. Damit hatte Japan einen Vorwand, um die Stadt zu besetzen und die wichtige Eisenbahnlinie unter seine Kontrolle zu bringen.
Man darf nicht vergessen, daß dieses Japan bereits 1895 Krieg gegen China geführt hatte, ebenso wie 1905 gegen Rußland. Beide Konflikte hatte Japan gewonnen, was zur Besetzung Taiwans, der südlichen Sachalin-Halbinsel und Koreas führte, daß 1905 besetzt und 1910 von Japan offiziell annektiert wurde.
Die Behauptung Japans war damals, daß die Mandschurei dabei war, „im Chaos zu versinken.“
Heute würde man hier vermutlich das Banner „Frieden, Demokratie und Menschenrechte“ schwingen, und die Banditen wären eben Terroristen, aber die Methoden kommen einem bei genauer Betrachtung recht vertraut vor.
Bis 1932 hatte Japan ganz Nordost-China besetzt und gründete dort den Marionettenstaat Mandschukuo. Wer den „Letzten Kaiser“ gesehen hat, kennt diese Geschichte. 1937 war also nur die Fortsetzung einer ganzen Politik aus dem, was heute unter Destabilisierung oder „regime change“ bekannt ist.
Auch die Frage nach dem Ende des Krieges gestaltet sich schwierig. In Europa endete er mit der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945, im Pazifikraum später, nämlich erst am 2. September, als Japan nach den ersten – und bisher letzten – Atombombenabwürfen der menschlichen Geschichte auf zwei seiner Städte offiziell kapitulierte. Wobei es auch nicht einmal diese Bomben waren, die zur Kapitulation führten. Das mußte hinterher nur so sein.
Geschichte ist oft diffus, enthält aber wiederkehrende Muster
In Bezug auf den 1. Weltkrieg sieht es ähnlich aus. Nach normaler Geschichtschreibung, die man so in der Schule lernt, endete dieser Konflikt am 11. November 1918, als das Deutsche Reich um Waffenstillstand bat.
Aber es dauerte noch eine ganze Weile, bis dann der Versailler Vertrag entstand, zu dessen Bedingungen die deutschen Verlierer als einzige nicht ein Mal angehört wurden. Ein Fehler der Siegermächte, der sich später als verheerend herausstellen sollte.
Anderswo gingen auch die bewaffneten Kämpfe weiter.
Das Zarenreich Rußland war zum Beispiel bereits 1917 aus dem Konflikt ausgeschieden, mit dem Frieden von Brest-Litowsk, in dem das Deutsche Reich sich große Gebiete sicherte. Danach versank das Land im Bürgerkrieg, in dem zwischen 1918 und 1920 etwa sieben Millionen Menschen kämpften und 1,5 Millionen ihr Leben verloren.
So kämpften die Polen, nachdem ihr Land im Zuge der Nachkriegsregelungen wieder auf den Karten Europas aufgetaucht war, zwischen 1918 und 1921 gegen die Ukraine, gegen Deutschland, Litauen und gegen Rußland. Schließlich erstreckte sich Polen wesentlich weiter nach Osten, als es die Friedensstifter in Versailles geplant hatten.
Auch bei der Aufteilung Kleinasiens, quasi die Konkursmasse des Osmanischen Reiches, ging nicht alles wirklich glatt. Das Gebiet sollte unter Griechenland, Frankreich und Italien aufgeteilt werden, außerdem sollten ein armenischer Staat und eine autonome kurdische Region entstehen. Auch bei diesem Vertrag, dem Vertrag von Sèvres, waren die Kriegsverlierer nicht gefragt worden.
Das wiederum rief einen Mann namens Mustafa Kemal Pascha auf den Plan, der mit seinen Anhängern zu den Waffen griff und am Ende alle potentiellen Besatzungsmächte besiegen konnte. Mit der Eroberung des bis dahin griechischen Smyrna (Izmir) endete der 1. Weltkrieg in dieser Gegend der Erde erst am 9. September 1922 und mit der Gründung der modernen Türkei. Unter anderem kam es in diesem Konflikt zum Völkermord an den Armeniern, den die türkische Regierung bis heute bestreitet. Es war nicht das erste Geschehen dieser Art im 20. Jahrhundert und es sollte bedauerlicherweise auch nicht das letzte bleiben.
Die Entstehung der reinen Nationalstaaten, wie sie bis heute die weltweite politische Landschaft beherrschen, brachte also eine Menge Blutvergießen mit sich.
Selbst die Bezeichnung der Weltkriege ist nicht zwingend schlüssig, denn – da sind sich die meisten Historiker sehr einig – ohne den Ersten Weltkrieg hätte es den Zweiten nicht gegeben.
Nimmt man die Konflikte anderer Völker mit dazu, die bis weit in die 20er Jahre hinein andauerten, und rechnet dann noch mit ein, daß sich in dieser Zeit in Italien bereits der Faschismus etablierte, wird die ganze Angelegenheit endgültig unscharf.
Im anglo-amerikanischen Raum gibt es nicht wenige Historiker, die die Periode von 1914 bis 1945 als „Zweiten 30jährigen Krieg“ bezeichnen.
Interessanterweise eine Bezeichnung, die ich selbst mir auch schon einmal überlegt hatte und der ich dann einige Jahre später auf einem SPIEGEL-Titel begegnete, ohne vorher von der akademischen Diskussion der Historiker über diesen Begriff – der übrigens bereits den 40er Jahren entstammt – irgendwas gehört zu haben.
Wie soll man also in diesem Durcheinander aus Wahnsinn, Irrsinn, Stumpfsinn und Blödsinn eine Möglichkeit finden, die Zukunft vorherzusagen?
Die 68er Generation warf dazu jede Menge LSD ein oder kiffte ein Dutzend Tüten pro Tag weg. Ich will nicht behaupten, daß so etwas nicht bewußtseinserweiternd sei, aber das mit der Zukunft wird dadurch nicht unbedingt besser. Ich meine, wenn Joschka Fischer 1968 gewußt hätte, in wen er sich bis 2015 verwandeln würde, hätte er sich doch freiwillig mit noch mehr Drogen das vorzeitige Nirwana verpaßt, oder?
Kommen wir also noch einmal zurück auf das Wetter.
Mit fortschreitender Erforschung dieses alltäglichen Phänomens wurde immer klarer, daß eine wirkliche Vorhersage bestenfalls schwierig sein würde.
Eine Kontrolle des Wetters wurde von den entsprechenden Fachleuten bereits zu den Akten gelegt, als diese Vorstellung in SF-Romanen noch sehr präsent war.
Wobei man in den 1940er Jahren zumindest die Methode des Wolkenimpfens mittels Silberjodid entwickelte, aber von einer globalen Wetterkontrolle ist das so weit entfernt wie ein Plastikmodell der Enterprise von einem funktionierenden Warpantrieb.
Einer der damals Beteiligten war übrigens ein Mann namens Bernard Vonnegut, dessen Nachname bei SF-Lesern sicherlich eine hochgezogene Augenbraue hervorrufen dürfte. Tatsächlich war Kurt Vonnegut sein Bruder.
So richtig Fahrt nahm die Meteorologie dann erst in den 60er Jahren auf. Und schuld daran war der Kalte Krieg. Den hatte ich ja im Beitrag der letzten Woche kurz mal erwähnt. Übrigens beendete der ebenfalls kurz angesprochene Koreakrieg den Zeitabschnitt, den der Historiker Niall Ferguson, noch über den Zweiten 30jährigen Krieg hinausgehend, in seinem gleichnamigen Buch als „Krieg der Welt“ bezeichnet hat, ebenfalls ein sehr treffender Ausdruck für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und – ganz nebenbei – ein hervorragendes Buch für den Interessierten.
Zusammen mit der Perfektionierung von Raketentechnik und Wettersatelliten kam noch eine erstaunliche Sache auf, die das Bild des 20. Jahrhunderts, eigentlich sogar unserer ganzen Zivilisation bis heute, tiefgreifend verändern sollte. Der Mikroprozessor wurde erfunden, 1971. Wie ich auch schon einmal erwähnt hatte: Manchmal können kleine, unvorhergesehene Dinge die Zukunft sehr entscheidend beeinflußen. Ob das jetzt atomare Spione sind oder ein kleines Dingsbums aus Silizium.
Eine lineare Fortschreibung der eigenen Lebenswelt führt normalerweise in eine falsche Zukunft
In diesem Zusammenhang wird auch immer gerne die Anekdote eines IBM-Ingenieurs zitiert, der bei der Vorstellung des besagten Mikroprozessors gesagt haben soll: „Ganz nett, aber wozu soll das gut sein?“
Das führt unmittelbar zu dem Satz des Gründers von IBM, Thomas J. Watson, der 1943 gesagt haben soll: „Ich denke, es gibt einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer.“
Allerdings waren die Computer eines Mr. Watson auch noch gigantische Röhrenmonster, mit denen man problemlos das Grönlandeis hätte schmelzen können. Die Leistung eines Taschenrechners der 80er Jahre in der handlichen Größe einer etwa fußballplatzgroßen Halle. Kein Wunder, daß sich Mr. Watson da so verschätzt hat. Die Heckflossigkeit der Dinge kann unterschiedlichste Formen annehmen, meistens eben im Kopf von Personen.
Ebenfalls kein Wunder ist, daß sich die Welt mit dieser Entwicklung in eine andere verwandeln sollte. Das Dingsbums aus Silizium war recht klein für damalige Verhältnisse, aber seine Auswirkungen sollten enorm sein.
Plötzlich hatten Meteorologen also etwas zur Verfügung, was bis dahin sehr kostbar und in den meisten Fällen schlicht unerschwinglich gewesen war: Rechenzeit.
Anstatt einen kybernetischen Röhrensimpel mit ihren Fragen zu belästigen, konnten sie dieselben Fragen jetzt einem kleinen Haufen geschmolzenem Dreck mit ein paar elektronischen Kontakten stellen. Und der beantwortete diese Fragen auch noch viel schneller als sein Dinosaurier-Kollege.
Eine der Antworten, die sich herauskristallisierten, war diese: Wetter ist chaotisch.
Damit war ganz klar, daß eine Wetterkontrolle oder auch nur eine absolut zuverlässige Vorhersage niemals möglich sein würde.
Außerdem wurde deutlich, daß man eben viel mehr über lokale Parameter erfahren müßte, um die Zuverlässigkeit weiter zu verbessern. Denn je genauer man die Anfangsbedingungen in einem nichtlinearen System kennt, desto besser kann man dessen Entwicklung vorhersagen. Seit den 60er Jahren haben besonders Wetterforscher begonnen, die Erde mit einem Netz aus neugierigen Sensoren zu überziehen, um ihre Disziplin voranzubringen.
Chaostheorie besagt nicht etwa, daß sich eine exakt gleiche Ausgangssituation zu unterschiedlichen Ergebnissen entwickeln muß. Das ist ein weitverbreiteter Irrtum, zumindest unter den Leuten, die überhaupt schon mal irgendwas von dieser seltsamen Theorie gehört haben. Kurz zusammengefaßt kann man sagen, daß normale Physik prima berechnen kann, wie ein Stein in einen Brunnen fällt. Wenn es darum geht, exakt vorauszuberechnen, wie ein Wasserhahn tropft, stoßen die üblichen Gleichungen plötzlich an ihre Grenzen.
Es ist so zum Beispiel durchaus möglich, eine Wettervorhersage zu erstellen, die für sieben Tage eine recht hohe Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Allerdings braucht man dazu eben eine breite Datenbasis und es ist von Vorteil, wenn die Basisparameter ruhig sind, also relativ wenige massive Schwankungen aufweisen.
Ändern sich diese Basisparameter sehr schnell und sehr stark, ist auch heute eine Vorhersage manchmal nicht einmal über 24 Stunden möglich, dabei sind die heutigen Computer ihren Kollegen aus den 7oer Jahren mindestens ebenso überlegen wie diese den Röhrenmonstren, die sie abgelöst hatten.
Aber wenn einem das Wetter in Schottland nicht gefällt, kann man in fünf Minuten ja noch einmal wiederkommen, wie die Schotten so sagen.
Nein, die wesentliche Erkenntnis der Chaosforschung besteht darin, daß sich innerhalb des scheinbar irregulären Verhaltens und trotz der Tatsache, daß eine langfristige Vorhersage für nichtlineare Systeme nicht möglich ist, innerhalb des Chaos immer wieder bestimmte typische Verhaltensmuster finden. Anders ausgedrückt, enthält Chaos immer irgendwo auch Ordnung.
Jeder, der in den 80er Jahren einen C64 zu Hause stehen hatte, ließ diesen Kasten etwas berechnen, das farbige und irgendwie ansehnliche Muster auf einem Monitor – damals meist der heimische Fernseher – ausgeben konnte: das „Apfelmännchen“.
In der Chaostheorie firmiert dieses bunte Etwas, das mich und andere damals so faszinierte, als „Mandelbrot-Menge“, nach ihrem Entdecker Benoît Mandelbrot.
Das System basiert auf einer quadratischen Gleichung und gilt als eines der formenreichsten existierenden Fraktale. Ein weiterer Begriff, der mit diesem Teil wissenschaftlicher Forschung zu tun hat, ist die Selbstähnlichkeit. Darauf werde ich irgendwann noch einmal zurückkommen, zumindest ist das der Plan.
Das Wetter, das Dreikörperproblem der Physik, das mir in der Schule begegnete, ebenso wie das Billardspiel sind Beispiele für chaotische Systeme.
Ich erinnere mich, damals die Physikstunde gesprengt zu haben, als ich an die Tafel kam und meinen Lehrer fragte, warum denn ein Planet sich nicht so bewegen könne – wobei ich eine achtförmige Umlaufbahn zwischen den beiden Sonnen hindurch zeichnete.
„Ich habe es schon immer gewußt“ ist meistens keine wahre Aussage
Die darauffolgende Erklärung und meine weiteren Fragen haben meinen Mitschülern damals entspannte 90 Minuten verschafft.
Ich wäre trotzdem ein lausiger Physiker geworden, da mein Talent zur Mathematik extrem begrenzt ist. Aber die theoretische Erörterung derartiger Probleme hat mir schon damals Vergnügen bereitet.
Die Frage nach der planetarischen Bahn entsprang eher meinem Interesse für SF-Literatur, nicht zwingend der Physik. Und auch mein über Jahre gepflegtes Hobby, nämlich das Billardspiel, war ein Hobby, kein Studium der Chaostheorie. Wobei – manchmal doch, wenn der verdammte Ball mal wieder exakt neben die Stelle an die Bande getitscht war, an der er sie eigentlich hätte treffen sollen. Für mich selber waren Chaostheorie, Zukunftsvisionen und Computertechnik schon immer etwas, das zusammengehört. Nur habe ich das eben erst später bemerkt.
Für den Blick in die Zukunft ist besonders interessant, daß die Chaostheorie in den Geschichtswissenschaften sogar bereits eingesetzt wird, nämlich zur Beschreibung von Krisen und Übergangszuständen. Die Idee einer möglichen Berechenbarkeit von Geschichte und somit der Zukunft ist also nicht neu, ob man da bei der Foundation-Trilogie von Asimov anfangen möchte oder bei der Chaosforschung der 60er und späterer Jahre.
Meine eigene Hypothese ist Folgende:
Eine Vorhersage der Zukunft ist nicht möglich. Eine Prognose mit hohem Wahrscheinlichkeitsgehalt aber sehr wohl.
Diese ist allerdings um so ungenauer, je weiter wir uns vom Jetzt entfernen, ähnlich wie bei einer Wettervorhersage auch. Ich persönlich würde einen Zeitraum von maximal zwei Dekaden als halbwegs „vorhersehbar“ annehmen.
Um ein brauchbares Bild zu bekommen, benötigt man außerdem eine möglichst breite Datenbasis. Da es bei der Zukunft immer um die Zukunft von Menschen bzw. der menschlichen Zivilisation geht, benötigt man also eine breite Datenbasis über Menschen und wie sie sich verhalten.
An dieser Stelle kommen dann Dinge wie Psychologie, Soziologie und Systemtheorie ins Spiel. Letztlich ist ein Blick in die Zukunft nur eine Frage der Anwendung wisenschaftlicher Methodik und der richtigen Werkzeuge und all diese Dinge stehen der Menschheit aktuell sehr wohl zur Verfügung.
Die Dynamik von Zukunft ist also immer die Dynamik von Menschenmengen, nicht Individuen.
Temporaldynamik ist die Dynamik von Massen, nicht Individuen. Und sie unterliegt einer Unschärferelation.
Futurologisch betrachtet verhält sich die Menschheit wohl mehr wie ein Gas, das Verhalten von einzelnen Molekülen ist nur für das Molekül interessant und im Gesamten weder vorhersagbar noch relevant. Anders gesagt: Je näher wir an den einzelnen Menschen rangehen, desto besser wird die Auflösung, oder, um die Wettermetapher noch einmal zu benutzen, die lokale Vorhersage.
Um aber die Klimaentwicklung zu erkennen, oder eben die Entwicklung der menschlichen Zivilisation im 21. Jahrhundert, muß man mit der Kamera weiter rauszoomen. Denn je näher wir rangehen, desto besser wird zwar die Auflösung, aber desto ungenauer wird eben auch das Ergebnis für das Gesamtsystem „Menschheit“. Für ein brauchbares Ergebnis muß man also weiter weg sein, was aber wiederum eine individuelle Vorhersage unmöglich macht.
Es ist demzufolge unmöglich, daß Verhalten einzelner Menschen oder die Zukunft einzelner Menschen vorherzusagen. Die Zigeunerin im Jahrmarktszelt und ihre Kristallkugel bleiben also bestenfalls amüsant, nicht unbedingt zuverlässig.
Man kann vorhersagen, daß es morgen auf der Straße glatt sein wird. Man kann nicht vorhersagen, ob ein bestimmter Jemand auf dem Eis ausrutschen oder sich dabei das Bein brechen wird.
Dieses Phänomen bezeichne ich als „Unschärferelation der Psychohistorik“, mit freundlichen Grüßen an Werner Heisenberg und Isaac Asimov.
Insgesamt ist mir der Ausdruck Temporaldynamik aber lieber, denn der Griff in die Geschichte soll ja immer der Klärung des Nebels über der Zukunft dienen, nicht der reinen Historik.
Sollte das schon jemandem eingefallen sein, muß er sich bei mir melden, dann taufe ich das um. Außerdem sollten wir dann mal zusammen einen Tee trinken und uns unterhalten. Zum Beispiel darüber, wie Menschen so denken und wie sie sich benehmen. Und vor allem, warum sie sich so benehmen. Das dürfte uns dann eine Weile beschäftigen.